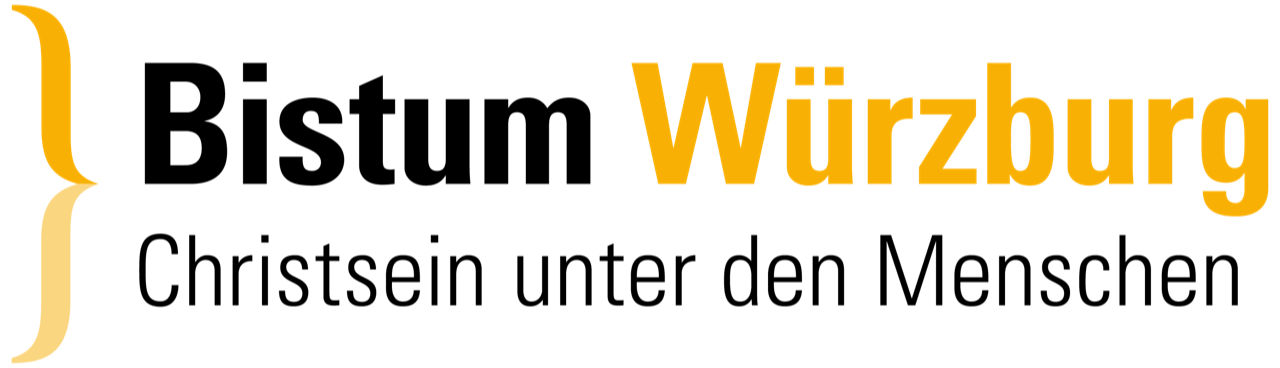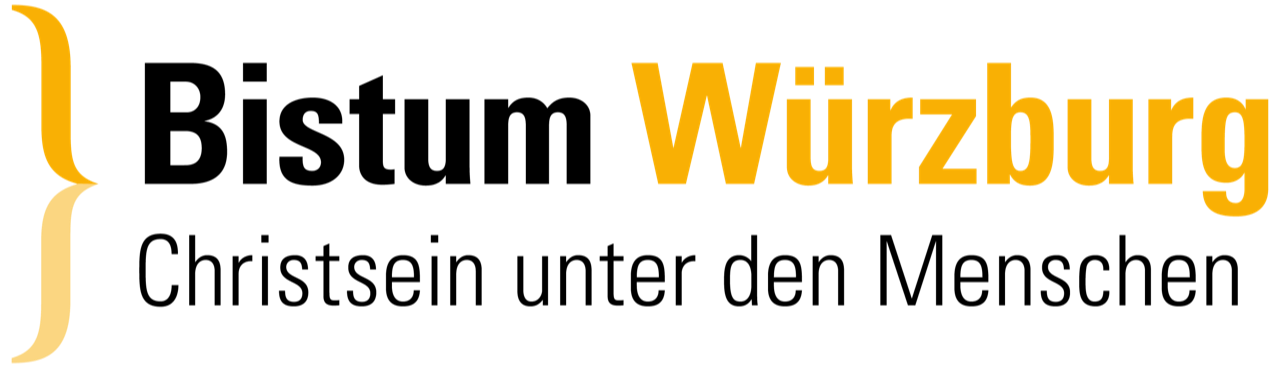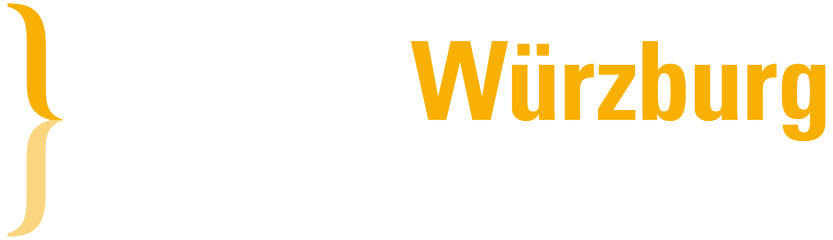„Schweig Bub!“
So lautet der Titel der wohl bekanntesten Konfirmation Frankens. In dem Volksstück von Fitzgerald Kusz feiert eine kleinbürgerliche Familie die Konfirmation ihres einzigen Sohnes. Alle Verwandten sind zu diesem Fest geladen, das aber mehr und mehr entgleist. Ungeniert tragen die Gäste ihre Konflikte vor dem Konfirmanden aus, zu dem die Mutter nur sagt: "Schweig Bub, sonst wird das Essen kalt!" Je später die Stunde, umso haltloser lässt man sich gehen. Also: „Schweig Bub!“
Auch in den kommenden Wochen um Ostern werden wieder viele Jugendliche in unseren evangelischen Kirchen konfirmiert. Durch die Konfirmation werden sie mündige Mitglieder der Kirchengemeinde, dürfen mitbestimmen und selber Paten für andere werden. Dazu müssen sie „Farbe bekennen“, indem sie vor der Gemeinde aufstehen und ihre, in der Taufe zugesagte Zugehörigkeit zu Gott, zum Glauben, zur christlichen Gemeinde bekräftigen. Also eben gerade nicht: „Schweig, Bub!“
Ein Blick in das Neue Testament zeigt uns, dass dort an keiner Stelle von Konfirmation die Rede ist. Dies hat seinen Grund darin, dass in der frühen Christenheit wohl vor allem Erwachsene getauft wurden, bei denen die Taufhandlung und das Bekenntnis des Täuflings zusammenfielen. Die Konfirmation wurde erst im Zuge der Reformationszeit entwickelt. Nachdem die Täuferbewegung der Auffassung war, dass nur getauft werden kann, wer zuvor auch glaubt, zogen sie auch die gängige Praxis der Kindstaufe in Frage. Der entscheidenden Kompromiss bestand darin, dass die Heranwachsenden einen Katechismusunterricht besuchen sollten, der in einem Bekenntnis vor der Gemeinde gipfelte: Die Konfirmation war geboren! Mit dem Pietismus, der die persönliche Frömmigkeit betonte, wurde die Konfirmation ab dem späten 17. Jahrhundert dann Allgemeingut in allen protestantischen Kirchen Deutschlands.
Die Art und Weise des Konfirmandenunterrichts hat sich seither verändert. Immer noch steht die Vermittlung der Grundlagen unseres christlichen Glaubens im Mittelpunkt, aber auch die eigene Persönlichkeitsentwicklung und das Erleben von Gemeinschaft. Am Ende der Konfirmandenzeit sollen sie sich dann zu ihrem christlichen Glauben bekennen: Sie sollen sich nicht verstecken, nicht schweigen, sondern zu dem stehen, wovon sie überzeugt sind und sich auch einbringen – in unsere Kirche ebenso wie in die Gesellschaft, in der wir leben. Und ganz besonders dort, wo etwas falsch läuft in der Welt. Da brauchen wir mündige Christinnen und Christen. Deshalb: Sprecht ihr jungen Leute!